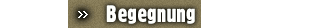ERWIN AUSPITZgeb. 1928-12-12lebt heute in Argentinien Ermordete Verwandte |
|
Diese Geschichte wurde im Projekt "Die Letzten Zeugen" erstellt.
Erwin Auspitz wird 1928 in Wien geboren. Nach dem Anschluss wird er gedemütigt, sein Vater verhaftet. Im Jänner 1939 kann die Familie von Hamburg aus mit dem Schiff nach Buenos Aires emigrieren. Erwin Auspitz ist 17, als der Krieg aus ist. Mit 24 heiratet er, erlebt auch die Militärdiktatur in seiner neuen Heimat und beginnt, sich mit seinen lange verdrängten Wurzeln auseinander zu setzen.
Die Landwirtschaftliche Fach- und Berufsschule für Gartenbau Ehrental war im Mai 2008 Gastgeber für Erwin Auspitz.
„Mit geliebter Heimat Frieden geschlossen“
Erwin Auspitz konnte als Kind nach Argentinien flüchten. Im Projekt »A Letter To The Stars« kam er wieder nach Wien.
 Im März 1938 war ich etwas über neun Jahre alt, Schüler der 4. und letzten Klasse der Volksschule der Lehrerbildungsanstalt in der Kundmanngasse im 3. Bezirk. Wir waren, wenn ich nicht irre, vier jüdische Kinder unter ca. 30 Buben.
Im März 1938 war ich etwas über neun Jahre alt, Schüler der 4. und letzten Klasse der Volksschule der Lehrerbildungsanstalt in der Kundmanngasse im 3. Bezirk. Wir waren, wenn ich nicht irre, vier jüdische Kinder unter ca. 30 Buben.Ich war immer ein recht guter Schüler gewesen und hatte nie, soweit ich mich erinnere, Schwierigkeiten mit meinen Mitschülern oder Lehrern, die auf mein Judentum zurückzuführen gewesen wären.
Am ersten Schultag nach dem Anschluss kam mein Lehrer mit erhobenem Arm und Hitlergruß in die Klasse und sämtliche Schüler wussten, dass es von nun ab »Heil Hitler« und nicht mehr »Guten Morgen« hieß. Auch war es allen klar – wieso eigentlich, dass man die jüdischen Mitschüler nun nicht mehr grüßt und überhaupt ignoriert. Zu Ehren meines Lehrers, dessen Namen ich vergessen habe, sei gesagt, dass er am ersten Schultag nach dem Anschluss mit Nachdruck gesagt hatte, er würde es nicht zulassen, dass die jüdischen Kinder belästigt würden. So konnte ich mein Schuljahr und meine Volksschule auf »normale« Weise, wenn auch abgesondert, absolvieren.
In anderen Situationen funktionierten die Dinge auf ähnliche Art und Weise. Wir hatten zum Beispiel Nachbarn, die Familie Anisic, deren Sohn Walter etwa in meinem Alter war. Jahrelang waren wir Spielkameraden gewesen, von Balkon zu Balkon, und auch da war es, als ob ich mich plötzlich in Luft verwandelt hätte.
Endgültig vorbei waren die Sonntagnachmittage, an denen mein Vater mich mitnahm nach Hütteldorf, zum Fußballplatz, wo wir zusammen für unsere geliebte Rapidmannschaft bangten. Vorbei war auch diese einzigartige Möglichkeit, meinen Vater für mich, nur für mich zu haben.
Einige Jahrzehnte später begann ich mich zu fragen, wie das alles vor sich gegangen war, wie kann man das erklären? Von einem Moment zum anderen wechselten Tausende Menschen ihr Verhalten. Was bis zum gestrigen Tag gewöhnlich war, galt heute als verpönt, oder auch umgekehrt, und sicher war es nicht notwendig, die Leute zu instruieren. Ebenso eigentümlich war mein eigenes Benehmen. Soweit ich zurückdenken kann war es mir vollkommen klar, dass sich meine Welt verändert hatte, obwohl meine Eltern mit mir nicht über die neuen Umstände sprachen. Wahrscheinlich konnten sie sich selbst auch nicht zurecht finden. Ich war verängstigt, verschüchtert, traurig. Aber nie kam mir der Gedanke, all dies wäre heller Wahnsinn, gegen jeden Anstand, Moral und Menschlichkeit. Ich akzeptierte die neuen Tatsachen, als wären sie die natürlichsten Dinge der Welt, ohne jeden Protest.
 Im übrigen: das war auch später so. Wir lebten schon viele Jahre in Buenos Aires, dreißig Jahre oder auch mehr, als ich mir zum ersten Mal die Frage stellte, wie wohl mein Leben ohne Hitler und Emigration gewesen wäre. Oder anders betrachtet: wie haben eben diese Tatsachen mein Leben umgestaltet? Noch etwas: warum dauerte es so lange, bis ich es wagte, mich mit diesen Überlegungen auseinander zu setzen? Ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich konzentrierte ich meine ganze Energie auf den Aufbau meines neuen Lebens und schob dieses Problem auf instinktive Weise weit, weit weg.
Im übrigen: das war auch später so. Wir lebten schon viele Jahre in Buenos Aires, dreißig Jahre oder auch mehr, als ich mir zum ersten Mal die Frage stellte, wie wohl mein Leben ohne Hitler und Emigration gewesen wäre. Oder anders betrachtet: wie haben eben diese Tatsachen mein Leben umgestaltet? Noch etwas: warum dauerte es so lange, bis ich es wagte, mich mit diesen Überlegungen auseinander zu setzen? Ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich konzentrierte ich meine ganze Energie auf den Aufbau meines neuen Lebens und schob dieses Problem auf instinktive Weise weit, weit weg.Wie schon erwähnt, ich konnte meine Volksschule beenden. Während der Sommerferien erlebten wir den ersten Arrest meines Vaters. Er wurde mit weiteren Juden von einem Kaffeehaus auf die Straße getrieben, musste zum Spaß der Umstehenden den Bürgersteig waschen und verblieb ein paar Wochen im Arrest. Wir mussten die Wohnung aufgeben, ich entsinne mich nicht des genauen Datums, lebten eine, ich glaube, kurze Zeit bei einer Tante, und dann, bis zur Emigration, in Untermiete bei einer Frau Weber in der Biberstrasse.
Bücher haben mir immer schon Spaß und Freude bereitet. Aber in diesen Monaten flüchtete ich fanatisch in alle mögliche Literatur. Schillers Wilhelm Tell las ich wieder und wieder, zu großen Teilen konnte ich das Werk auswendig. Als wir bei meiner Tante wohnten, stöberte ich in der Bibliothek meiner ältesten Kusine. Sie war bedeutend älter als ich, damals schon eine junge Ärztin. Zum ersten Mal kam ich da mit sozial-politischer Literatur in Kontakt. Ich erinnere mich zum Beispiel an die vielen Romane von Upton Sinclair, die mir eine neue Welt offenbar machten.
In jene Zeit fallen auch die wenigen Wochen, oder vielleicht waren es ein paar Monate, in welchen ich mich bewusst jüdisch fühlte, selbst in einem gewissen religiösen Sinn. Religion hatte in meiner Familie nie eine besondere Rolle gespielt. Mein Vater war ungläubig, meine Mutter ging ein oder zwei Mal im Jahr in den Tempel (zu den Feiertagen) – und nicht viel mehr. Religionsunterricht war ja damals obligatorisch, so wusste ich natürlich, dass es Unterschiede gab, aber ich erinnere mich nicht, dass mich diese Begebenheit im Laufe der Jahre beschäftigt hätte. Plötzlich wurde das anders. Gleichzeitig kam das Thema einer eventuellen Auswanderung nach Palästina zur Sprache, und zwar sollten nur wir Kinder dort mit einem Transport hinkommen. Ich denke, die Notwendigkeit, an irgendetwas zu glauben, sich an irgendetwas festzuhalten, bestimmte meine damalige Reaktion. Auf nur kurze Zeit. Ab jener Zeit, und bis zu den heutigen Tagen, war ich mir meiner Zugehörigkeit bewusst. Was nicht bedeuten soll, dass dies immer die selbe Einstellung gewesen wäre.
Meiner bescheidenen Meinung nach ist die Frage der Zugehörigkeit zum Judentum und die der möglichen Assimilation eine sehr komplizierte. Heute bin ich überzeugt, dass uns – selbstverständlich auch ohne Hitler – eine Menge historischer und kultureller Tatsachen den Stempel des Judentums aufgedrückt haben.
Doch möchte ich zwei Begebenheiten festhalten. Die eine wäre der Morgen des 10. November 38, in der überfüllten 1. Klasse des Chajes-Gymnasiums. Die Väter von uns allen waren an diesem Tag verhaftet worden, ebenso alle männlichen Lehrer. Die Bedrücktheit und Traurigkeit, die uns alle heimsuchten und vor allem das absurde Schamgefühl, als ob wir etwas verbrochen hätten, all dies ist noch heute irgendwo in mir verpflanzt. Die andere Episode bezieht sich auf meinen täglichen Weg ins Gymnasium. Um uns ein wenig sicherer zu fühlen, gingen wir in kleinen Gruppen, zwei bis vier Kinder, zusammen. Trotzdem kam es vor, dass einige Hitlerjungen, ca. 15 bis 17 Jahre alt, uns auf alle nur mögliche Art und Weise belästigten. Manchmal fuchtelten sie uns mit ihren Dolchen vor der Nase herum. Auf der Scheide stand, ich glaube mich richtig zu erinnern, »Blut und Ehre«.
 Wenn ich heute an diese Episoden zurückdenke, sage ich mir zweierlei. Dieses widerstandslose Akzeptieren der Gewalt bestimmte für mein ganzes Leben ein gestörtes Verhältnis zu den Behörden. Andererseits frage ich mich: was tut »normalerweise« ein Junge, ein Halbwüchsiger, dem man einen Dolch in die Hand drückt und sagt: Geh, Du bist die Macht. Gäbe es viele, die sich weigern würden? Ich bezweifle es. Im Januar 1939 schifften wir uns in Hamburg auf dem Dampfer M.S. Monte Rosa der Gesellschaft Hamburg-Süd ein. Im Großen und Ganzen war es eine recht schöne Reise. Doch wir waren auf deutschem Boden, und deshalb war es unzulässig, dass ich, ein zehnjähriger Junge, eine Lederhose trug. Laut dem Gesichtspunkt eines Schiffsoffiziers wäre dies eine Beleidigung für das deutsche Volk. Ich kam auch ohne Lederhose gesund in Buenos Aires an.
Wenn ich heute an diese Episoden zurückdenke, sage ich mir zweierlei. Dieses widerstandslose Akzeptieren der Gewalt bestimmte für mein ganzes Leben ein gestörtes Verhältnis zu den Behörden. Andererseits frage ich mich: was tut »normalerweise« ein Junge, ein Halbwüchsiger, dem man einen Dolch in die Hand drückt und sagt: Geh, Du bist die Macht. Gäbe es viele, die sich weigern würden? Ich bezweifle es. Im Januar 1939 schifften wir uns in Hamburg auf dem Dampfer M.S. Monte Rosa der Gesellschaft Hamburg-Süd ein. Im Großen und Ganzen war es eine recht schöne Reise. Doch wir waren auf deutschem Boden, und deshalb war es unzulässig, dass ich, ein zehnjähriger Junge, eine Lederhose trug. Laut dem Gesichtspunkt eines Schiffsoffiziers wäre dies eine Beleidigung für das deutsche Volk. Ich kam auch ohne Lederhose gesund in Buenos Aires an.Aber Diskriminierung gab und gibt es auch anderer Art. Nicht nur die Nazis und/oder die Deutschen waren dazu fähig. In Lissabon stiegen Portugiesen ein. Sie emigrierten nach Brasilien. Einfache Leute, meist Fischer. Sicherlich, ihre Körperpflege ließ viel zu wünschen übrig, und die Düfte, die sich auf dem Sektor verbreiteten, beleidigten die jüdisch/deutschen Nasen. Den Vorschlag eines jungen Ehepaars folgend, unterschrieben die jüdischen Emigranten ein an den Kapitän adressiertes Gesuch, die Portugiesen in einem anderen Sektor des Schiffs unterzubringen. Die sofortige Reaktion des Kapitäns bestimmte, sämtliche Juden, die das Gesuch unterschrieben hatten, am ersten Hafen auszuschiffen und sie zurück nach Deutschland zu bringen. Unter den betroffenen »Verbrechern« befanden sich auch meine Schwester und ich. Meine Eltern waren nicht darunter, denn sie waren seekrank, als die Forderung verfasst wurde. Schließlich beschränkte sich der Kapitän darauf, »nur« das Ehepaar auszuschiffen, das die ursprüngliche Idee gehabt hatte.
Während der Überfahrt sollte ich Spanisch lernen, aber ich weigerte mich ständig. Warum, ist wohl Thema der Psychologie. Schließlich, dank der Bemühungen, erlernte ich die Zahlen, konnte also von eins bis hundert auf Spanisch zählen, als wir am 14. Februar 1939 in Buenos Aires ankamen. Wenige Wochen später, Anfang März, begann die Schule. Meine Eltern schulten mich in einer argentinischen öffentlichen Schule ein. In Folge dessen befand ich mich plötzlich in einer Gruppe von ca. 25 Jungens, die mich mit verständlicher Neugierde anschauten. Europa, eine andere Sprache, jemand, der nicht verstehen konnte, was man ihm sagte, andere Kleidung, andere Sitten, alles war sicher sehr sonderbar, nicht nur für mich als der »leidende« Teil, auch für alle Mitschüler. Aber diese nicht geplante Rosskur erwies sich als sehr nützlich. Ich erlernte die spanische Sprache in erstaunlich kurzer Zeit, und spreche sie ohne jeden Akzent. Ein paar Monate später glaubte man mir nicht, dass ich Ausländer wäre. Im übrigen, ich habe eine schöne Erinnerung an dieses Schuljahr. Wohl machten sich meine Schulkameraden so manchen Spaß mit mir, ich war nun eben irgendwie anders, doch anderseits wurde ich ohne Widerstand akzeptiert. Ich war einer mehr, beim Fußball oder sonstigen Spielen.
Da wir über keinerlei finanzielle Mittel verfügten, war Geldverdienen die erste Priorität, und jeder machte nach seinen Möglichkeiten mit. Meine Mutter und meine Schwester erstellten Handarbeiten, meine Mutter, sie war eine besonders gute Köchin, erzeugte Torten, Süßigkeiten u.a.m., und mein Vater verkaufte das alles. Meine Arbeit war das Austragen. So fuhr ich durch die fremde große Stadt und lernte sie rasch kennen.
Im Laufe der Jahre ging es dann besser, und obwohl mein Heim immer ein bescheidener Haushalt war, nie fehlte es am Unerlässlichen. Mein Vater lebte ca. 14 Jahre in Buenos Aires und ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Von der materiellen Seite abgesehen, der seelische Schaden war tief und beständig. Die Art der Beschäftigung, die er ausführte, war seiner nicht würdig. Ich muss einräumen, andere haben es verstanden, aber er konnte sich nie eine Tätigkeit aufbauen, die seinen Möglichkeiten entsprach. Er war ein äußerst intelligenter, liebenswerter und charmanter Mann. Nie konnte ich verstehen, dass ein Mann, der den damaligen Umständen tapfer in die Augen sah, dem es gelang, sich und seine Familie in Sicherheit zu bringen, allen Schwierigkeiten zum Trotz, dann plötzlich nicht mehr die Kraft und/oder den Willen hatte, für sich selbst um ein besseres Leben zu kämpfen.
In mir lebt der Schmerz bis zum heutigen Tag und wird es sicherlich immer tun.
 Ich bin der Ansicht, dass sich meine Assimilation in der neuen Heimat rascher als bei den meisten Emigrantenkindern vollzog. In den ersten Jahren hatte ich noch stellenweise Kontakt mit österreichischen oder deutschsprechenden Kreisen. Später beschränkte sich dieser auf einige Freunde meiner älteren Schwester und ich lebte mich immer mehr in argentinische Kreise ein. Erst viele Jahre später wurde mir bewusst, dass meine österreichische Herkunft tief in mir verwurzelt war.
Ich bin der Ansicht, dass sich meine Assimilation in der neuen Heimat rascher als bei den meisten Emigrantenkindern vollzog. In den ersten Jahren hatte ich noch stellenweise Kontakt mit österreichischen oder deutschsprechenden Kreisen. Später beschränkte sich dieser auf einige Freunde meiner älteren Schwester und ich lebte mich immer mehr in argentinische Kreise ein. Erst viele Jahre später wurde mir bewusst, dass meine österreichische Herkunft tief in mir verwurzelt war.Als 1945 der Krieg zu Ende ging, war ich noch nicht 17 Jahre alt. Natürlich waren wir begeistert, erfreut. Nicht nur, dass die Nazis den Krieg verloren hatten, wir, ich meine, viele meiner Generation, waren in unserer Naivität überzeugt, eine neue, ideale, schöne und gerechte Welt würde unsere Zukunft kennzeichnen. Langsam, aber ständig, ohne Unterbrechungen, belehrten uns die Begebenheiten eines Besseren. So lange der Krieg andauerte, war es einfach: Die Nazis waren die Bösen, die Alliierten die Guten, es gab keine Zweifel. Das wurde dann anders. Es war schmerzlich, äußerst schmerzlich, sich einzugestehen, dass Anstand nur bis zu einem gewissen Grad mit Ideologie zu tun hat. Bis zum heutigen Tag mache ich es mir zur Aufgabe, so objektiv wie möglich zu sein, immer Meinungsverschiedenheiten zu respektieren.
Anfang 1953 habe ich, 24 Jahre alt, meine Lebensgefährtin geheiratet. Sie war damals 21 Jahre alt, kam in Buenos Aires zur Welt, ihre Eltern waren in Russland geboren. Unsere Eltern sahen sich anfangs »schief« an. Für meine Eltern waren die ihrigen »Ostjuden«. Für ihre waren meine »Jekes«. Im Laufe der Jahre lernten sie sich lieb zu haben, aber, ein Mal mehr, wurde mir bewusst, dass Diskriminierung und Vorurteile überall vorhanden sind.
Wie schon erwähnt dauerte es ca. 30 Jahre, also mehr oder weniger bis in die 70er-Jahre, bis ich begann, mich ernstlich mit meiner Vergangenheit und Geschichte auseinander zu setzen. Unter anderem waren die politischen Umstände in Argentinien, eine fürchterliche Militärdiktatur mit 30.000 Menschen, die einfach verschwanden, entscheidend. Es waren schwere Jahre. Gewalt beiderseits, obwohl das natürlich nicht gleichzustellen ist. Aber kompliziert genug, um uns ein verwirrtes Leben zu bereiten. Es dauerte noch einige Jahre, bis ich mich im Jahre 1985 endlich zu einer Reise in die Heimat aufraffte.
Zu diesem Zeitpunkt war es mir klar, was ich wissen wollte. Kann sich die Geschichte wiederholen? Was denken die Menschen über die Begebenheiten von damals? Gab es immer noch Antisemitismus? Es waren 40 Jahre nach dem Kriegsende vergangen und ich war entschlossen, alles Mögliche zu tun, um Antworten zu erhalten. So verpasste ich keine Gelegenheit, auf der Straße, in Geschäften, Restaurants etc., etc. meinen jeweiligen Gesprächspartner wissen zu lassen, dass ich 1939 das Land verlassen musste. Fast ohne Ausnahme war die Antwort entweder Schweigen, so zu tun, als ob man nicht gehört hätte, oder, meistens, mir zu erzählen, wie schwer die Kriegsjahre für sie selbst gewesen waren, was sicherlich absolut wahr war. Von den vielen Erinnerungen, die ich von den damaligen Besuch in Österreich habe, möchte ich zwei Episoden erzählen.
 Ich wollte gerne die Wohnung, in der ich meine Kindheit verbrachte, sehen. So machten Musia und ich uns eines Samstagnachmittags auf und fuhren in die Hainburgerstrasse im 3. Bezirk. Gerne würde ich die Gedanken und Gefühle mit euch teilen, die mir durch den Kopf gingen, als ich vor dem Eingang stand. Es ist mir nicht möglich. Ich weiß nur, dass ich sehr verwirrt und aufs Äußerste gespannt war. Schließlich läutete ich, und ein Mann, ein paar Jahre älter als ich, öffnete uns und sah uns recht freundlich an. In wenigen Worten erklärte ich ihm meinen Wunsch. Wenn Sie es uns erlauben, würden wir gerne die Wohnung ansehen, denn ich lebte hier bis 1938, dann mussten ich und meine Familie auswandern. Seine Antwort war:
Ich wollte gerne die Wohnung, in der ich meine Kindheit verbrachte, sehen. So machten Musia und ich uns eines Samstagnachmittags auf und fuhren in die Hainburgerstrasse im 3. Bezirk. Gerne würde ich die Gedanken und Gefühle mit euch teilen, die mir durch den Kopf gingen, als ich vor dem Eingang stand. Es ist mir nicht möglich. Ich weiß nur, dass ich sehr verwirrt und aufs Äußerste gespannt war. Schließlich läutete ich, und ein Mann, ein paar Jahre älter als ich, öffnete uns und sah uns recht freundlich an. In wenigen Worten erklärte ich ihm meinen Wunsch. Wenn Sie es uns erlauben, würden wir gerne die Wohnung ansehen, denn ich lebte hier bis 1938, dann mussten ich und meine Familie auswandern. Seine Antwort war:Gerne, kommen Sie weiter, aber, sagen Sie mir, Sie sagten, 1938 mussten Sie auswandern? Also sind Sie Jude! Sie können es mir ruhig sagen. Ich bin Sozialist! Ich denke, er hätte keine klarere Art und Weise finden können, mich wissen zu lassen, dass es weiter Antisemitismus in Österreich gab, und zwar in bedeutendem Ausmaß. Wir verbrachten mit dem Mann und seiner Frau eine interessante und freundliche Stunde. Immer wieder lud er mich ein, die Wohnung anzusehen, was im übrigen recht einfach war, denn es handelte sich um eine kleine Zwei-Zimmer-Küche-Bad-Wohnung. Beide waren freundlich und recht nett und aufmerksam mit uns. Beide erzählten uns viele aufschlussreiche Begebenheiten aus ihrem Leben, besonders von den Kriegsjahren.
Aber keiner fragte nach meinem Leben in der Emigration.
Ein paar Tage später genossen wir einen kurzen Aufenthalt in Tirol, in einem kleinen Ort, Igls, ganz in der Nähe von Innsbruck. Ich war begeistert und glücklich, ich hatte meinen geliebten Wald wieder. So machten wir eine Menge Spaziergänge und erfreuten uns der Hasen und Eichhörnchen, die uns über den Weg liefen. Eines Tages, ca. zur Mittagszeit, kamen wir zu einem wunderschönen Platz, umgeben von herrlichen, beschneiten Bergen. Wir fühlten uns im Paradies und beschlossen in einem dortigen Restaurant etwas zu essen. Wir teilten uns einen Tisch mit einem Ehepaar, mit dem wir rasch ins Gespräch kamen. Wie üblich tischte ich meine Botschaft auf. Die sofortige Reaktion, mit Pathos: ja, wir haben von all dem nichts gewusst. Absolut nichts gewusst. Und dann, wie üblich, die eigene Geschichte. Er war Offizier der Luftwaffe gewesen und machte als solcher den Krieg mit. Und er erzählte, wie er an der russischen Front Bombermissionen ausführte. Es war nicht leicht für Musia, hat sie doch dort ihre Familie verloren, dies alles anzuhören. Doch das Essen verlief friedlich und wir hörten eine Menge hochinteressanter Dinge über das damalige Österreich, das schöne Leben dieses Ehepaars, und vieles andere mehr. Als es zum Aufbruch kam, beschlossen wir, zusammen bergab zu gehen. Einer dummen Tradition folgend, gingen wir Männer voran und die zwei Frauen hinterher. Bei dieser Gelegenheit kam es zu einem sehr schwer wiederzugebenden Gespräch. Es sei vorausgeschickt, es fiel ihm unerhört schwer zu sagen, was er sagen wollte. Er unterbrach sich selbst ständig, wurde stellenweise unzusammenhängend. Also, plötzlich, wie aus heiteren Himmel, sagte er: Wissen Sie, mein Vater musste aus Innsbruck weg, als die Deutschen kamen. Und warum? Ja, mein Vater war Schuster und war bei der »Roten Winterhilfe« tätig. Und wohin ging er? Nach Polen (ich erinnere mich nicht mehr an den Namen des Ortes), dort lebte ein Cousin von ihm, Schuster wie er selbst. Besuchten Sie ihren Vater während des Krieges? Ja, ein oder ein anderes Mal. Und einmal, wissen Sie, einmal gab er mir ein Paket mit. An diesem Punkt angelangt, wusste ich nicht mehr, was er mir erzählen wollte. Alles war sehr konfus. Aber schließlich teilte er mir folgende Tatsache mit. Der Cousin des Vaters hatte seinerseits einen Sohn, der aus politischen Gründen in einem Lager war. Und ihm, dem Sohn, sollte er ein Paket mit Lebensmitteln, oder sonstigem, ins Lager bringen. Und was taten Sie, fragte ich. Na, ich nahm das Paket in Empfang und gestehe Ihnen, der erste Impuls war, es verschwinden zu lassen. Aber, zu guter Letzt, riss ich mich zusammen und brachte es ins Lager. Wie ging es Ihnen da? Anfangs wollten sie das Paket in Empfang nehmen, um es angeblich später auszuhändigen, aber ich bestand darauf, ihn zu sehen und konnte es auch erreichen. Wahrscheinlich dank der Uniform eines Offiziers der Luftwaffe, die ich trug. Also musste ich eine gute Weile warten, und dann kam mein Cousin. Ich gab ihm das Paket, das sein Vater gesandt hatte und wusste nichts zu sagen. So rasch ich konnte entledigte ich mich meiner Aufgabe. Und ich sage Ihnen, nie, nie in meinem ganzen Leben fühlte ich mich so erleichtert wie in dem Moment, als ich hörte, dass sich das Tor des Lagers hinter mir schloss.
Dieser Mann, derselbe Mann, hatte zwei oder drei Stunden vorher mit erhobenen Armen zum Himmel geschaut und beteuert: Wir haben von all dem nichts gewusst!
 Ich will es nicht unterlassen, über eine einzige Ausnahme zu berichten. Auf der Fahrt von Wien nach Salzburg lernten wir Brigitta Fritsch kennen. Sie war allein, hatte einen ihrer Söhne in Wien besucht, und auf dem Weg nach Hause. Sie und wir waren allein in einem Abteil, und wir kamen bald ins Gespräch. Brigitta war ca. ein Jahr älter als ich, sehr religiös (katholisch). In Salzburg ansässig, arbeitete sie in den Kriegsjahren im Privathaus eines Lageroffiziers und hatte so Gelegenheit, so manches zu sehen und zu hören. Ich erinnere mich, dass sie beschrieb, wie sie und die Frau des Offiziers einem Häftling, den ihr Mann das eine oder andere Mal zur Arbeit nach Hause brachte, heimlich ein Stück Brot zusteckte. In Ängsten, wie sie sagte. Brigitta hat es verstanden, uns über unser Leben in der Emigration auszufragen. Mit offenem Verstand und – vor allem – mit offenem Herzen. Wir wurden Freunde und die Freundschaft dauerte an.
Ich will es nicht unterlassen, über eine einzige Ausnahme zu berichten. Auf der Fahrt von Wien nach Salzburg lernten wir Brigitta Fritsch kennen. Sie war allein, hatte einen ihrer Söhne in Wien besucht, und auf dem Weg nach Hause. Sie und wir waren allein in einem Abteil, und wir kamen bald ins Gespräch. Brigitta war ca. ein Jahr älter als ich, sehr religiös (katholisch). In Salzburg ansässig, arbeitete sie in den Kriegsjahren im Privathaus eines Lageroffiziers und hatte so Gelegenheit, so manches zu sehen und zu hören. Ich erinnere mich, dass sie beschrieb, wie sie und die Frau des Offiziers einem Häftling, den ihr Mann das eine oder andere Mal zur Arbeit nach Hause brachte, heimlich ein Stück Brot zusteckte. In Ängsten, wie sie sagte. Brigitta hat es verstanden, uns über unser Leben in der Emigration auszufragen. Mit offenem Verstand und – vor allem – mit offenem Herzen. Wir wurden Freunde und die Freundschaft dauerte an.Ende 2007 kam die Einladung von »A Letter To The Stars«, vom 1. bis zum 8. Mai 2008 nach Wien zu kommen. Ich könnte nicht sagen, was größer war, die Überraschung oder die Freude? Die Vorbereitung der Reise, ich meine das stetige Überdenken der Aufgabe, die mich erwartete, füllte mich gänzlich aus. Insbesondere der Vorschlag, meine Lebenserfahrung mit Jugendlichen einer Schule zu teilen, hat mich begeistert.
Meinen Lebenslauf anderen, besonders Jugendlichen, mitzuteilen, ist schon an sich eine schöne Aufgabe und kann sicherlich denselben recht nützlich sein. Doch ich wollte mehr. Es genügte mir absolut nicht, die Schüler nur zum Zuhören, nein, ich setzte mir zum Ziel, sie zum Überlegen zu bringen. Ich wollte versuchen, sie zu ermuntern, sich an die Stelle anderer, auch an die von mir und vieler anderer, zu denken. Es war mir klar, dass mit Sicherheit die meisten Vorfahren dieser jungen Leute damals aktive Nazis waren, oder im besten Fall passiv und wahrscheinlich mit Sympathie den damaligen Umständen zusahen. Ich war absolut nicht gewillt, diese Tatsachen zu verheimlichen. Im Gegenteil, ich wollte sie ans Tageslicht bringen, selbstverständlich ohne
irgend jemandem weh zu tun. Dieses Vorhaben füllte mich voll und ganz aus und es verging kaum ein Tag, ohne dass ich daran dachte.
Die Korrespondenz, die ich mit Ronald Pistrol, dem Lehrer meiner Gastgeber-Schule, hatte, war ein schönes Vorzeichen für die unvergesslichen zwei Tage, die wir mit ihm, seinen Kollegen und den Schülern in Klagenfurt verbrachten. Der Vorschlag von »A Letter To The Stars«, ein paar Worte für ein Plakat zu schreiben, war eine weitere Überraschung. Ich war sehr gerührt und habe mir den Text lange überlegt. Als mir dann in Wien angeboten wurde, am Heldenplatz zu sprechen, wusste ich plötzlich nicht mehr aus und ein. Ich habe diese Tage praktisch an nichts Anderes gedacht, aber zum Ende war ich zufrieden mit dem Text, den ich dann sprach. Die Verantwortung, die ich auf mich genommen hatte, lag schwer auf meinen Schultern. Würde es mir gelingen, den Seelen der Menschen, die mich anhörten, nahe zu kommen? Nie werde ich das Vertrauen, das ihr und auch viele andere, vor allem meine Familie, mir entgegenbrachten, vergessen.
1985 kehrte ich verbittert und skeptisch zurück nach Buenos Aires. Diesmal war ich freudig und fühlte, in gewissen Sinn hatte ich mit meiner geliebten Heimat Frieden geschlossen.
Schon sind wieder viele Monate vergangen, seit wir von unserer Reise zurück nach Buenos Aires kamen. Aber, ob Ihr es glaubt oder nicht, für mich und ich traue mich zu sagen für uns, kam sie noch nicht zu einem Ende. Ständig empfange ich die verschiedensten Signale. Alle möglichen Momente hallen wieder und bereichern mein Leben. Die Hoffnung, meiner Umwelt und meinen Mitmenschen, wenn auch nur in ganz kleinem Ausmaß, etwas gegeben, irgendjemandem gut getan zu haben, spendet mir Glück und Zufriedenheit ! Danke!
»Dann können wir uns in die Augen schauen«
Rede von Erwin Auspitz am 5. Mai 2008 auf dem Wiener Heldenplatz

Ich stehe vor Euch in Trauer und Tränen. Die 6 Millionen Schwestern und Brüder der Shoa, die 6 Millionen unschuldiger Menschen, die von den Nazis brutal vernichtet wurden, sie sind der Rahmen unseres Treffens. Ich verbeuge mich zu ihrem Gedenken.
Doch zu jeder Zeit, an jedem Ort, der Mensch hat es immer verstanden, seinen Menschenbruder zu peinigen, zu demütigen, zu ermorden. Argentinien, das Land, das meine Familie und mich aufnahm, als wir Österreich und das geliebte Wien verlassen mussten, erlebte und erlitt vor ca. 30 Jahren eine fürchterliche Militärdiktatur. 30.000 Menschen verschwanden. Los desaparecidos. Sie waren nicht am Leben, aber niemand grub ihnen ihr Grab.
Was tun angesichts so vieler Gewalt?
Wir Überlebende wissen es möglicherweise besser als so mancher, Gewalt führt nur zu mehr Gewalt. Nicht zu Lösungen.
Doch es bleibt uns ein Weg. Die Suche nach Wahrheit. Ich möchte sagen, nach wahrer, nackter und unbeschönigter Wahrheit. Suchen wir in uns selbst. Was hätten wir getan, wären wir anstatt anderer gewesen. An Stelle unserer Familie, unserer Nachbarn, Kollegen, ja selbst an der der Verbrecher und deren Opfer? Was hätten wir gedacht, gemacht, gefühlt ? So viele, unendlich viele Fragen. Und keine klare Antwort. Aber unsere Suche, unsere schmerzvolle und ehrliche Suche nach der Wahrheit, sie wird uns Erfolg spenden: Anstand und Menschlichkeit, dies wird unser Erfolg sein. Und dann, dann dürfen wir uns freuen. Und dann können wir uns in die Augen schauen, uns an den Händen nehmen, und träumen: NIE WIEDER !