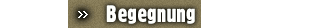CHANA KÄTHE
(früher Stux) |
|
Diese Geschichte wurde im Projekt "Botschafter" erstellt.
Julia Felberbauer hat als »Botschafterin der Erinnerung« im April 2008 Käthe Rubinstein in Israel besucht und ihre Lebensgeschichte dokumentiert. Im Mai 2008 war die Heilstättenschule Wien unter der Schulleiterin Ingrid Schierer Gastgeber für Käthe Rubinstein.
Chana Käthe Rubinstein wird 1925 als Käthe Stux in Wien geboren. Beim Anschluss ist sie 13 Jahre alt, mit 18 Jahren wird sie ins KZ Theresienstadt deportiert, wo sie im Kinderheim mit ansehen muss, wie die Kinder in die Gaskammern von Auschwitz geschickt werden. Sie überlebt das KZ und kann nach Israel auswandern, wo sie mit ihrem Mann, der wie sie den Holocaust überlebt hat, ein neues Leben beginnt.
Die verlorenen Kinder von Theresienstadt
Chana Käthe Rubinstein war 18 und Krankenschwester, als sie ins KZ kam. Jetzt erzählte sie ihre Geschichte Kindern der Heilstättenschule.
Ich habe in Israel gemeinsam mit meiner Kollegin Agnes Vana die Holocaust-Überlebenden Chana Käthe Rubinstein und Benjamin Ben-Rechav besucht. Die beiden kennen sich schon seit Kinder- bzw. Jugendtagen, überlebten gemeinsam das Konzentrationslager Theresienstadt und gehören seit der Heirat ihrer Eltern auch zur selben Familie.Frau Rubinstein, mit der ich vor meiner Reise nach Israel brieflichen und telefonischen Kontakt hatte, durfte ich als »Botschafterin der Erinnerung« in Tiberias am See Genezareth zum ersten Mal treffen.
 Kindheit und Jugend in Österreich
Kindheit und Jugend in Österreich
Chana Käthe Rubinstein wurde als Käthe Stux am 2. Februar 1925 als Tochter von Paul und Stefanie Stux in Wien geboren. Ihre gesamte Jugend wurde von der NS-Diktatur bestimmt – zur Zeit des »Anschlusses« war sie 13 Jahre alt und wurde im Alter von 20 Jahren aus dem Konzentrationslager Theresienstadt befreit. Frau Rubinstein kann sich heute nicht mehr vorstellen, wie es möglich war, so zu leben, wie sie und ihre Familie damals – in ihrer Freiheit extrem eingeschränkt – lebten. Sie mussten ihre Wohnung im 15. Bezirk aufgeben, einen »Judenstern« tragen, durften die Straßenbahn nicht mehr benutzen, nicht mehr in Geschäften einkaufen, nicht mehr telefonieren, keinen Kontakt mehr mit Nichtjuden haben. Aus heutiger Perspektive weiß sie nicht mehr, wie sie als Jugendliche im Wachstum genug Nahrung bekam und so ein Leben überhaupt ertragen konnte. Sie bekam auch die ganze Zeit über nie neue Schuhe und Kleider. Um sich selbst in dieser einengenden und gefährlichen Situation zu helfen, riskierte sie sogar einmal, nach Einbruch der Dunkelheit ohne ihren »Judenstern« außer Haus zu gehen, das heißt sich als »Arierin« auszugeben und auf einem Gemüsemarkt hinter der Stefanskirche Essen einzukaufen. Trotzdem sagt sie heute, dass sie als Jugendliche diese Zeit anders erlebt hat als ihre Eltern, die natürlich immer sehr besorgt waren, während sie selbst zu ihrem Glück diese Qual nicht so stark erlebte.
Nach dem »Anschluss« ging sie noch ein Jahr lang zur Schule, danach aber war ihr Leben durch und durch von Arbeit bestimmt. Im Alter von 15 Jahren begann sie ihre Tätigkeit als Krankenschwester in einem Säuglingsheim und später in einem neueröffneten Kinderspital in der Ferdinandstraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk, das sie im Jahr 1940 aufnahm. Frau Rubinstein war für die dortige Ambulanz zuständig, wo sie Kinder mit ansteckenden Krankheiten betreute. In dieser Ambulanz traf sie zum ersten Mal auf den damals dreijährigen Benjamin Ben-Rechav und seinen Bruder Uri.
In der Sperlgasse im 2. Bezirk gab es ein Sammellager, von dem aus Menschen in das KZ Theresienstadt deportiert und sehr kranke Kinder von der SS in das Kinderspital geschickt wurden, welches selber über sehr wenige Medikamente verfügte.
Frau Rubinstein erlebte diese Zeit als sehr schwierig, da sie das Leiden, den Tod und die Deportation vieler Kinder mit ansehen musste und die schwere und traurige Aufgabe hatte, die verstorbenen Kinder aus dem Spital zu bringen, wenn diese vom Bestattungsunternehmen abgeholt wurden. Die Kinder, die sie und die anderen Schwestern gesund pflegen konnten, wurden wieder in das Lager in der Sperlgasse gebracht und von dort mit ihren Eltern in verschiedene Konzentrationslager deportiert.
Gegenüber dem Kinderspital, in dem Frau Rubinstein arbeitete, befand sich ein Kinderheim, das sich um verwaiste und zurückgelassene Kinder, sowie später auch sogenannte »Mischlingskinder« kümmerte. Letztere hatten einen jüdischen und einen nichtjüdischen Elternteil und waren aufgrund ihrer Herkunft von ihren Klosterschulen verwiesen worden.
Konzentrationslager Theresienstadt
Im Jahr 1943 wurde Frau Rubinstein im Alter von 18 Jahren gemeinsam mit ihrer Familie als einige der letzten sogenannten »Volljuden« in Wien in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Dort musste sie in einem Säuglingsheim und später in einem Spital mit lungenkranken Waisenkindern arbeiten. Von diesen Kindern wurden etwa einhundert im Jahr 1944 nach Auschwitz deportiert, und nur eine Krankenschwester und eine Patientin, die sich als Krankenschwester ausgeben konnte, kamen zurück. Auch nach der Befreiung des Konzentrationslagers blieb Frau Rubinstein eine Zeit lang in Theresienstadt, um sich um die zurückgebliebenen, verwaisten Kinder zu kümmern.Jeder Tag im KZ brachte quälende Ungewissheit und Angst mit sich, weil immer die Möglichkeit bestand, in ein anderes KZ deportiert zu werden. Allgegenwärtig war auch der Zynismus der SSler, die es sich sehr gut gehen ließen, während die Inhaftierten täglich mit Arbeit, Krankheit und Tod konfrontiert waren. Nur anlässlich des Besuchs des Komitees des Roten Kreuzes wurde der Anschein einer »heilen« Lagerwelt, in der alle gut versorgt waren, erweckt. Frau Rubinstein musste damals in einem für den Besuch des Komitees errichteten Kinderheim arbeiten, nach dessen Ende zwei Kindertransporte in die Schweiz, alle anderen nachfolgenden jedoch in die Gaskammern von Auschwitz geschickt wurden.
Sie berichtete mir von dem für mich deutlichsten und schockierendsten Ausdruck der Menschenverachtung und des Zynismus der SS, der sogenannten »Judenseife«, die die Häftlinge zum Waschen bekamen und von der sie erst später erfuhren, dass sie aus den Knochen der von den Nazis ermordeten Juden hergestellt wurde. Sie konnte und kann sich nicht vor-
stellen, wie die SS-Männer, die so viele Menschenleben auf dem Gewissen hatten, abends nach Hause zu ihren Familien gehen konnten, wie sie überhaupt mit ihren Taten leben konnten. Sie fragte sich immer wieder, was sie und die anderen Juden angestellt hätten, um mit solcher Grausamkeit behandelt zu werden und der Willkür der Nazis völlig ausgeliefert zu sein, und hoffte einfach nur, dass alles schnell vorbeigehen würde. Ihre Hoffnung hielt sie mit den immer wieder durchsickernden Durchhaltebotschaften »von außen« aufrecht. Zu ihrem Glück konnten die Nazis die Gaskammern, die sie in Theresienstadt gegen Kriegsende zu errichten begannen, nicht mehr fertig stellen. Trotzdem starben im Lager viele Menschen an Krankheiten wie z.B. Bauchtyphus.
Nach der Befreiung
Frau Rubinsteins Mutter war sehr krank, und obwohl ihre Familie ihr Bestes versucht hatte, sie im KZ Theresienstadt durchzubringen, verstarb sie 1946 im »Displaced Persons«-Lager (DP-Lager) Deggendorf in Bayern, das zu der von den USA besetzten Zone gehörte, wo sie, ihr Ehemann und ihre Tochter nach der Befreiung des KZ hingebracht wurden. Auch dort richtete Frau Rubinstein ein Kinderheim für die im Lager ankommenden Kinder ein. Sie selbst litt auch an schweren gesundheitlichen Problemen und musste wegen einer Typhusinfektion 1947 operiert werden.Während ihres Aufenthalts im DP-Lager lernte sie auch ihren aus Polen kommenden zukünftigen Ehemann kennen, der seine gesamte Familie in der Shoa verloren hatte. Die beiden heirateten 1946 und wanderten im darauffolgenden Jahr nach Israel aus. Ihr Bruder, der sich schon in einem Kibbutz in Israel befand, schickte von dort aus an seine Angehörigen Zertifikate, die sie zu Auswanderung benutzen sollten, doch inzwischen war Frau Rubinsteins Mutter leider schon verstorben, sodass Herr Ben-Rechavs Mutter, die auch in Deggendorf war, dieses Zertifikat übernahm.
Frau Rubinstein wurde von einer jüdischen Organisation auf die Auswanderung nach Palästina vorbereitet und kam über Marseille in Frankreich ins Land, wo sie wieder einen Krieg und schlechte Lebensbedingungen miterleben musste. Es war aber das Wichtigste für sie, Europa hinter sich gelassen zu haben und endlich in Israel zu sein.
Umgang mit den Erinnerungen an die Shoa
Frau Rubinstein erzählte ihren Kindern nicht von der Shoa, weil sie sich wünschte, dass sie normal aufwachsen und nicht leiden sollten, und weil sie in Israel neu anfangen und alles Vergangene hinter sich lassen wollte. Es war für sie und ihren Mann, die beide an nächtlichen Alpträumen aufgrundihrer Vergangenheit litten, schon schwer genug, mit dem Erlebten umzugehen, und ihre Kinder fragten auch von sich selbst aus kaum nach. Erst mit der Generation der Enkelkinder trat für sie die Vergangenheit wieder mehr in den Vordergrund, und heute ist es ihr wichtig, dass Jugendliche und Erwachsene sowohl in Israel als auch in Österreich den Holocaust in Erinnerung behalten, und dass den immer noch oder wieder den Holocaust leugnenden Menschen widersprochen wird. Ihre Enkel lernen in der Schule über den Holocaust und stellen ihrer Großmutter häufig dazu Fragen. Mit fortschreitendem Alter fällt es ihr immer leichter, diese zu beantworten.Ich bin sehr dankbar, dass Frau Rubinstein sich bereit erklärte, ihre Lebensgeschichte mit mir zu teilen, obwohl sie mich bis zu unserem Gespräch noch nie getroffen hatte und es sicher nicht leicht ist, einem fremden Menschen so persönliche und leidvolle Erinnerungen mitzuteilen. Deswegen ist es mir umso wichtiger, Frau Rubinsteins Geschichte zu bewahren, weiterzugeben und auf dieser Basis zu handeln, um nicht nur der Vergangenheit zu gedenken, sondern auch die Gegenwart zu verändern.