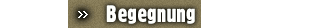INGE SCHWARCZ(früher Wolffenstein)geb. 1921-05-08 lebt heute in Argentinien |
|
Diese Geschichte wurde im Projekt "Die Letzten Zeugen" erstellt.
Die Hauptschule Grieskirchen in Oberösterreich war im Mai 2008 im Projekt »38/08« Gastgeber für Inge Schwarcz. Das Team um Lehrer Rudolf Jung hat gemeinsam mit dem Linzer Künstler Roland Haider ein Gedicht aus dem Tagebuch der Anne Frank in großformatige Acrylbilder umgesetzt und diese im »Denk.Mal«-Projekt den ermordeten Familienmitgliedern von Inge Schwarcz gewidmet.
Inge Schwarcz wird 1921 in Berlin geboren. Ihr Bruder kann 1938 nach Argentinien flüchten. Sie schafft es, gemeinsam mit ihrer Mutter 1940 ebenfalls nach Argentinien ausreisen zu dürfen. Doch zu diesem Zeitpunkt herrscht bereits Krieg, es gibt keine Schiffe mehr nach Südamerika. So bleibt Inge Schwarcz nur der Weg durch die halbe Welt.
»Mein Schmerz braucht dein Verständnis«
Inge Schwarcz konnte mit ihrer Mutter mitten im Krieg durch die halbe Welt von Berlin nach Argentinien flüchten – zu ihrem Bruder.
 Nun werde ich versuchen, Ihnen so kurz wie möglich – um Ihnen nicht zu viel Ihrer kostbaren Zeit zu stehlen – meine Lebensgeschichte zu erzählen.
Nun werde ich versuchen, Ihnen so kurz wie möglich – um Ihnen nicht zu viel Ihrer kostbaren Zeit zu stehlen – meine Lebensgeschichte zu erzählen.Ich wurde am 9. Mai 1921 in Berlin geboren. Wie Sie daraus entnehmen können, bin ich Deutsche. Ich war 60 Jahre lang glücklich mit einem Wiener verheiratet und bin in dessen Familie – nachdem ich meine eigene früh verloren habe – aufgegangen. Es ging soweit, dass er manchmal deutsche Wörter und ich österreichische gebraucht habe und die Kinder Schwierigkeiten hatten, welchen der beiden Dialekte sie benutzen sollten.
Meine bewusste Kindheit und Jugend habe ich in der Hitlerzeit verbracht. Als gute Sportlerin – ich erlangte einige Medaillen bei Schulsportfesten – konnte ich die Obersekundarreife in der städtischen »Fürstin Bismarckschule« erhalten. Meine jüdischen Mitschülerinnen wurden fast alle ausgeschult und in jüdische Schulen geschickt. Ich hatte es mir jedoch in den Kopf gesetzt, mein Einjähriges in einer städtischen Schule zu machen. Ich hatte das große Glück – ein Umstand, der mir später das Leben retten sollte – neben Französisch und Englisch freiwillig Spanisch zu lernen, allerdings bei einer deutschen Lehrerin, die einige Jahre in Barcelona gelebt hatte und der ich meinen deutschen Akzent verdanke, den ich nie mehr ablegen konnte. Anschließend ging ich auf die Sprachenschule der jüdischen Gemeinde, wo Spanisch, Englisch, Deutsch, Schreibmaschine und Stenografie gelehrt wurde. Diesem Sprachinstitut verdanke ich meine Anstellung als fremdsprachige Sekretärin am zweiten Tag meiner Ankunft in Buenos Aires, mit gutem Gehalt, besser als mein Bruder, der bei General Motors arbeitete und während des Krieges als Deutscher gekündigt wurde. Damals schrieb er uns »in Deutschland war ich kein Deutscher und hier wirft man mich als ›Deutscher‹ hinaus.«
Nachdem wir Anfang 1938 aus unserer Wohnung in der Wielandstrasse 33 hinausgeworfen worden sind, zogen wir zu meinem Onkel, Zahnarzt Dr. Paul Landsberger, in die Kantstrasse, wo wir auch bald hinaus mussten und in einer Notwohnung, einem ausgebauten Laden, endeten: meine Groß-mutter, meine Mutter, Onkel und Tante und Cousine in zwei kleinen Zimmern. Wir mussten zuschauen, wie unsere Möbel versteigert wurden. Mein Bruder hatte mir noch ans Herz gelegt: »Alles kann man dir nehmen, aber mein Klavier und die Bücher nicht.« Ich musste nun hilflos zusehen, wie alles unter den Hammer ging. Dies ist wohl der Grund, warum ich nie mehr an materiellem Gut gehangen bin, nur an ideellem, das einem keiner wegnehmen kann.
Im Jahre 1938 wanderte mein Bruder nach Argentinien aus. Da er acht Jahre älter war als ich und mein Vater starb, als ich zwei Jahre alt war, nahm er für meine Mutter und mich eine wichtige Rolle ein. Wir waren einerseits glücklich, dass er sich retten konnte, andererseits stimmte es uns sehr traurig, ihn zu verlieren. Im Jahr 1940 durfte er schließlich seine Mutter anfordern. Die Gesetze waren allerdings sehr streng in Argentinien – Geschwisteranforderungen gab es zu dieser Zeit keine mehr. Ich verlor den Mut trotzdem nicht. Ich war jung, ich wollte leben und so ging ich zum argentinischen Konsulat in Berlin – obwohl der Konsul als großer Antisemit bekannt war. Er war sehr erstaunt, eine junge Berlinerin zu treffen, die so gut Spanisch mit ihm sprach. Ich erzählte ihm mein Schicksal, weinte traurig, und zum Schluss saßen wir beide auf seinem Sofa mit einem großen Taschentuch und heulten um die Wette.
Am Ende fertigte er mir eine so genannte »llamada« (eine Anforderung) aus, mit der mein Bruder mich gemeinsam mit der Mutter anfordern konnte. Die einzige Geschwisteranforderung im Jahr 1940!
Unsere Schwierigkeit lag nun darin, russisches Visa zu erlangen und da lernte ich zum ersten Mal, was »bestechen« ist. Man sagte uns, dass wir 10 Mark in den Pass legen müssten, um das Visum zu bekommen. Sie fragen sicher, warum das russische Visum? Nun, es war ja bereits Krieg und deshalb liefen keine europäischen Schiffe mehr nach Südamerika aus. Russland war zu diesem Zeitpunkt mit Deutschland befreundet.
Wir fuhren mit dem Zug, zwei Wochen lang auf harten Bänken, über Polen und Russland bis nach Sibirien, wo wir in einem kleinen Schiff bei bewegtem Seegang über das japanische Meer übersetzten, um in Yokohama, Japan, die »Brasil Maru« zu nehmen, die uns über Los Angeles und den Panamakanal nach Buenos Aires brachte.
 Meine Mutter und ich waren auf dieser Reise sehr leichtsinnig. Wir trennten uns einmal von der Gruppe, um meinen Onkel Dr. Walter Wolffenstein – ein bekannter Hausarzt in Berlin, der auch nach Asien ausgewandert war – zu besuchen. Er war mit seinen Kindern und der Erzieherin – seine katholische Frau hatte sich von ihm getrennt – dort. Die katholische Kirche wollte ihm damals die zwei Kinder aus dem Zug holen, aber es gelang ihm, sie mitzunehmen. Wir verbrachten einen schönen Tag mit unseren Verwandten, aßen Kukuruz mit den Händen – etwas, das wir in Berlin nicht kannten – und fuhren Rikscha. Wir nahmen Abschied und jetzt kam die Schwierigkeit, an die keiner gedacht hatte. Wir verstanden kein Wort, alle sprachen nur Russisch, bis ich eine Touristenführerin fand, die ein wenig Deutsch sprach und uns zum richtigen Zug nach Moskau führte, wo wir, blass vor Schreck und schon ungeduldig von der Gruppe erwartet, ankamen. Wir hatten laut Erzählung der anderen viel versäumt, eine Rundfahrt durch Moskau, mit herrlichen breiten Strassen, dem Kreml, der Untergrundbahn mit einer 47 Meter tiefen Rolltreppe. Man hatte ihnen das Modell des damals, im Jahre 1940, größten Baues der Welt, gezeigt, 400 Meter hoch und oben eine 100 Meter hohe Statue von Lenin.
Meine Mutter und ich waren auf dieser Reise sehr leichtsinnig. Wir trennten uns einmal von der Gruppe, um meinen Onkel Dr. Walter Wolffenstein – ein bekannter Hausarzt in Berlin, der auch nach Asien ausgewandert war – zu besuchen. Er war mit seinen Kindern und der Erzieherin – seine katholische Frau hatte sich von ihm getrennt – dort. Die katholische Kirche wollte ihm damals die zwei Kinder aus dem Zug holen, aber es gelang ihm, sie mitzunehmen. Wir verbrachten einen schönen Tag mit unseren Verwandten, aßen Kukuruz mit den Händen – etwas, das wir in Berlin nicht kannten – und fuhren Rikscha. Wir nahmen Abschied und jetzt kam die Schwierigkeit, an die keiner gedacht hatte. Wir verstanden kein Wort, alle sprachen nur Russisch, bis ich eine Touristenführerin fand, die ein wenig Deutsch sprach und uns zum richtigen Zug nach Moskau führte, wo wir, blass vor Schreck und schon ungeduldig von der Gruppe erwartet, ankamen. Wir hatten laut Erzählung der anderen viel versäumt, eine Rundfahrt durch Moskau, mit herrlichen breiten Strassen, dem Kreml, der Untergrundbahn mit einer 47 Meter tiefen Rolltreppe. Man hatte ihnen das Modell des damals, im Jahre 1940, größten Baues der Welt, gezeigt, 400 Meter hoch und oben eine 100 Meter hohe Statue von Lenin. Es ging weiter nach Sibirien, in schmutzigen Zügen. Dabei muss ich noch von einem traurigen Erlebnis erzählen, das uns zutiefst erschütterte: In Omsk wurde der Zug von einer Schar zerlumpter, verwahrlost aussehender Männer, Frauen und Kinder umringt – jüdische Flüchtlinge aus Polen, die dort in ausrangierten Eisenbahnwagons kampierten und nichts zu essen hatten. Sie flehten uns um Essen an, und wir gaben ihnen von dem wenigen, was wir hatten.
 Nachdem wir die russische Steppe passiert hatten – von Städten sahen wir nichts, da der Zug immer nur kurz hielt – ging es weiter nach Irkutsk, wo die Gegend schöner wurde, am Baikalsee entlang mit herrlich klarem Wasser, von Bergen umgeben. Die Gegend war dünn besiedelt, nur wenige elende Hütten. Dann über die russisch-mandschurische Grenze mit sehr strengen Zollrevisionen. Danach ging es übers Japanische Meer, bei bewegtem Seegang und mit vielen Seekranken. Die Überfahrt dauerte ungefähr acht Stunden – von Fusan nach Shimoniseki. Und weiter mit dem Zug nach Kobe. Es war ein gewaltiger Unterschied zwischen den schmutzigen russischen Zügen und der japanischen Eisenbahn, die tipp topp in Ordnung war. In Kobe angekommen stellte sich heraus, dass die Hälfte der Gruppe ihre Dokumente nicht in Ordnung hatte und eine Freundin und ich – beide Sekretärinnen – wurden beauftragt, diese in drei Tagen (wir arbeiteten Tag und Nacht) in Ordnung zu bringen. Und wir schafften es, dass alle sich in die »Brasil Maru« einschiffen konnten. Die »Brasil Maru« war ein 10-Tonnen- Schiff, die 1. und 2. Klasse sehr schön, unsere natürlich sehr primitiv, das Essen knapp und schlecht. Unsere Kabine war so klein, dass erst die einzig Dicke hinein musste, damit die anderen Platz hatten. In Yokohama schiffte sich ein junger Mann ein, der Englisch und Japanisch sprach und uns während der Schiffsreise oft half. Er erklärte uns zum Beispiel, dass das einzige freie Waschbecken auf dem Deck – wir mussten uns daraus waschen – für Trachomkranke war und wir uns auf keinen Fall daraus waschen sollten. Unsere Reisetour ging über Los Angeles, den Panamakanal, Maracaibo (Venezuela), wo wir ausnahmsweise an Land durften, vorbei an Georgetown, Paramaribo, Fortaleza (Brasilien), Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, Porto Alegre, Montevideo und endlich Buenos Aires, wo uns mein Bruder erwartete.
Nachdem wir die russische Steppe passiert hatten – von Städten sahen wir nichts, da der Zug immer nur kurz hielt – ging es weiter nach Irkutsk, wo die Gegend schöner wurde, am Baikalsee entlang mit herrlich klarem Wasser, von Bergen umgeben. Die Gegend war dünn besiedelt, nur wenige elende Hütten. Dann über die russisch-mandschurische Grenze mit sehr strengen Zollrevisionen. Danach ging es übers Japanische Meer, bei bewegtem Seegang und mit vielen Seekranken. Die Überfahrt dauerte ungefähr acht Stunden – von Fusan nach Shimoniseki. Und weiter mit dem Zug nach Kobe. Es war ein gewaltiger Unterschied zwischen den schmutzigen russischen Zügen und der japanischen Eisenbahn, die tipp topp in Ordnung war. In Kobe angekommen stellte sich heraus, dass die Hälfte der Gruppe ihre Dokumente nicht in Ordnung hatte und eine Freundin und ich – beide Sekretärinnen – wurden beauftragt, diese in drei Tagen (wir arbeiteten Tag und Nacht) in Ordnung zu bringen. Und wir schafften es, dass alle sich in die »Brasil Maru« einschiffen konnten. Die »Brasil Maru« war ein 10-Tonnen- Schiff, die 1. und 2. Klasse sehr schön, unsere natürlich sehr primitiv, das Essen knapp und schlecht. Unsere Kabine war so klein, dass erst die einzig Dicke hinein musste, damit die anderen Platz hatten. In Yokohama schiffte sich ein junger Mann ein, der Englisch und Japanisch sprach und uns während der Schiffsreise oft half. Er erklärte uns zum Beispiel, dass das einzige freie Waschbecken auf dem Deck – wir mussten uns daraus waschen – für Trachomkranke war und wir uns auf keinen Fall daraus waschen sollten. Unsere Reisetour ging über Los Angeles, den Panamakanal, Maracaibo (Venezuela), wo wir ausnahmsweise an Land durften, vorbei an Georgetown, Paramaribo, Fortaleza (Brasilien), Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, Porto Alegre, Montevideo und endlich Buenos Aires, wo uns mein Bruder erwartete.In Buenos Aires lernte ich meinen Mann kennen. Er war Mediziner und da er im Hospital in Österreich nicht angenommen wurde – er pflegte zu sagen »mein positives Pech« – folgte er seinem Bruder nach Mailand und rettete sich so vor der Gestapo, die ihn einen Tag nach seiner Abreise abholen wollte, weil er in der sozialistischen Studentenbewegung tätig ge-wesen war. Statt ihm wurde mein Schwiegervater mitgenommen, der aber wieder freigelassen wurde, da er beweisen konnte, dass er Auswanderungsmöglichkeiten hatte. Wir arbeiteten beide in all den Jahren schwer. Er studierte und machte die Rivaldia für Odontologie, da dieses Studium kürzer war als das für Medizin, und verdiente sein Geld mit technischen Übersetzungen. Ich arbeitete als Sekretärin im Hochschild-Minenkonzern.
Wir waren jung und schafften es, haben zwei wunderbare Söhne, reizende tüchtige Schwiegertöchter und vier besonders liebe Enkelkinder – davon ist die älteste verheiratet. Es tut mir sehr leid, dass mein Mann die liebenswürdige Einladung nach Wien nicht mehr erleben konnte, er wäre sicherlich froh, wenn er wüsste, dass ich noch einmal sein geliebtes Wien miterleben kann.